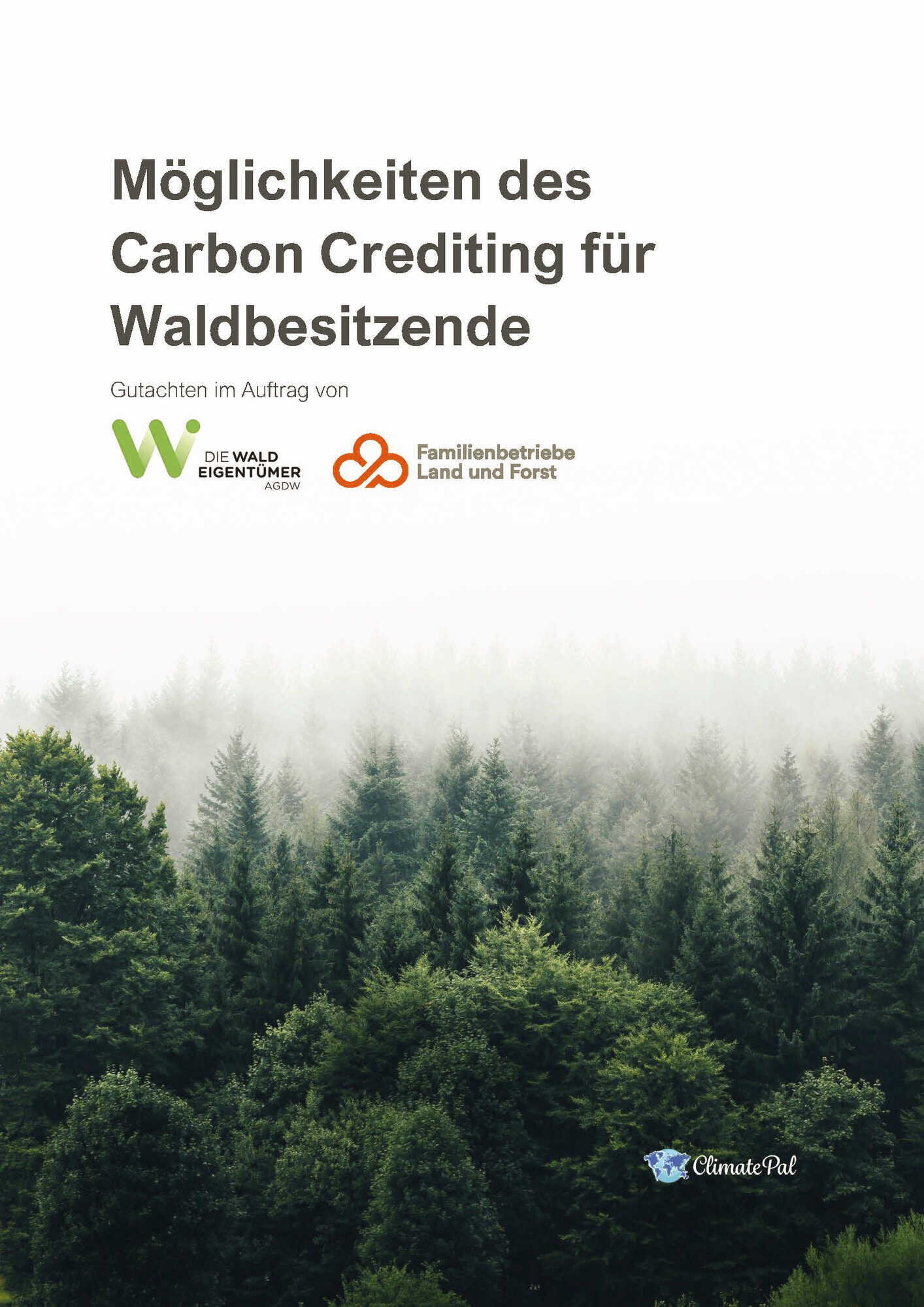Die Thementische des BuKo 2024
Der Bundeskongress für Führungskräfte Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse (BuKo) wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Zusammenarbeit mit der AGDW – Die Waldeigentümer und der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) ausgerichtet. Schwerpunktthema im Jahr 2024 war die Einordnung forstpolitischer EU-Themen. Nach einführenden Impulsvorträgen wurde der Einfluss der EU auf die nationale Waldpolitik in einer anschließenden Podiumsdiskussion vertieft. Am Tag zuvor folgte nach dem Bericht des BMEL zu den aktuellen nationalen forstpolitischen Themen die Durchführung der fünf Thementische. Hierauf wird im Folgenden näher eingegangen.
Thementisch 1: Digitalisierung Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse – Prozessanalyse als Voraussetzung
Text: Nina Meyer
„Wir machen alle das Gleiche, aber jeder macht es anders“, so Andreas Täger, Sprecher des Initiativkreises (IK) FWZ in der AGDW, zum Auftakt des Thementisches „Digitalisierung Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse – Prozessanalyse als Voraussetzung“. Soll heißen: Mit Beratung, Holzvermarktung, Mitgliederverwaltung und Abrechnung beschäftigen sich alle FWZ, die digitale Umsetzung erfolgt jedoch ganz unterschiedlich – von der Excel-Tabelle bis hin zu hochspezialisierten Warenwirtschafts- und Kundenmanagement-Systemen. Sowohl bei FWZ wie auch bei bisher waldfernen Eigentümern als Zielgruppe sieht Täger viel Potenzial, aber zugleich auch hohen Beratungsbedarf.
„Standardisierte und digitalisierte Arbeitsprozesse sind eine gute Basis, um mehr Zeit für die Beratung zu gewinnen“, betonte Täger. Deutlich wurde beim Thementisch mit seinen rd. 60 Teilnehmenden: Um Arbeitsprozesse digitalisieren zu können, ist zunächst eine detaillierte Beschreibung aller relevanten Arbeitsschritte erforderlich, z. B. in Bezug auf Mitglieder-, Geo- und Flächeninformationen, Auftragsplanung und -erteilung oder Gesprächsnotizen aus der Beratung. Positiver Nebeneffekt: Das Bewusstsein für die eigenen Betriebsabläufe kann gestärkt und Optimierungsmöglichkeiten können auf dieser Basis gefunden werden.
Klar wurde auch: Eindeutig definierte, digital abgebildete Arbeitsprozesse erleichtern nicht nur die tägliche Arbeit, sondern sind auch bei Personalwechsel, Urlaubs- und Krankheitsvertretung oder Elternzeit hilfreich. Gesicherte Arbeitsprozesse schützen vor Wissensverlust und unterstützen neues Personal beim Einstieg. Im nächsten Schritt ermöglicht die Prozessanalyse die Auswertung von Daten und kann damit Planungs- und Entscheidungsprozesse beschleunigen. Die Prozessanalyse schafft damit auch die Voraussetzung für die erfolgreiche weitere Digitalisierung eines FWZ.
Wie erhalten Führungskräfte eines FWZ Zugang zum Prozessmanagement? Den Leitfaden „Hilfestellung zur Prozessabbildung und -optimierung der FWZ“ empfahl dafür Nancy Müller von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) als Hilfsmittel. Der Leitfaden dient Führungskräften zur Einarbeitung in das Thema, zur Darstellung einer digitalen Infrastruktur sowie zum Wissenstransfer und Coaching.
Eine kurze Umfrage unter den Teilnehmenden – zumeist Führungspersonal aus FWZ – zum Kenntnisstand im Bereich Prozessmanagement ergab, dass sich die meisten als „erfahren“ einschätzen. Die meisten Antworten auf die Frage, ob sie für ihren FWZ Prozessmanagement betreiben, lagen im Spektrum von „gar nicht“ bis „sehr gut“ im Mittelfeld. Eigene Erfahrungen der Teilnehmenden im Prozessmanagement waren in der regen Diskussion der Veranstaltung ebenso Thema wie Hindernisse und Bedenken.
Insbesondere der hohe zeitliche Aufwand der Prozessbeschreibung und -analyse wurde kritisch gesehen. Um Führungskräfte und Mitarbeitende einzubeziehen und Widerstände abzubauen, sei ein begleitendes Change-Management sinnvoll, so Andreas Täger und Nancy Müller. Oftmals mangele es auch am Digitalisierungsgrad der Mitglieder, z. B., wenn E-Mail-Adressen fehlen. Teilnehmende berichteten darüber hinaus von kostspieligen Korrekturen nach der Einführung digitaler Lösungen ohne vorherige Prozessbeschreibung und -analyse. Am Ende der Veranstaltung sprachen sich nahezu alle Teilnehmenden dafür aus, dass FWZ standardisierte Prozesse benötigen.
Thementisch 2: Risikomanagement bei Holzgeschäften der FWZ – Zahlungen absichern mit einer Warenkreditversicherung
Text: Alexander Knebel
Mit den Volatilitäten der vergangenen Jahre hat auf den Holzmärkten die Zahl der Player merklich zugenommen. Doch ob man als FWZ mit Neulingen ins Geschäft kommt oder auf einen bekannten Kreis bewährter Abnehmer setzt – ein Risikomanagement empfiehlt sich in jedem Fall. Das wurde beim Thementisch „Risikomanagement bei Holzgeschäften der FWZ – Zahlungen absichern mit einer Warenkreditversicherung“ deutlich.
Von guten Erfahrungen mit solchen Versicherungen berichteten Birgitt Ulrich, Geschäftsführerin der FV Unterfranken, und aus der Nachbarregion Jörg Ermert, Geschäftsführer der FV Oberfranken. Zugleich machten sie klar, dass es neben der Warenkreditversicherung auch die Bürgschaft als Absicherungsinstrument gibt. Nachteil der Bürgschaft: Die Höhe der Summe, die abgesichert werden muss, verändert sich ständig, je nach Holzpreisen und Absatzmenge, wie Ermert deutlich machte. Bürgschaften werden meist für ein Jahr hinterlegt und können daher nicht auf diese Schwankungen reagieren. Die abgesicherte Summe ist daher meist zu hoch, es entstehen unnötige Kosten, so Ermert. Hingegen werden die Kosten der Warenkreditversicherung am Umsatz ausgerichtet. Etwa ein bis zwei Promille des Umsatzes müsse für Warenkreditversicherungen aufgewendet werden, erläuterten Ermert und Ulrich. Angesichts der Kalamitäten, mit denen man auch in Franken nun zu tun hat, sind je nach Region bei erhöhtem Holzeinschlag auch steigende Umsätze zu verzeichnen – entsprechend müssen dann allerdings auch Warenkreditversicherungen angepasst werden.
Ulrich und Ermert machten vor diesem Hintergrund klar: Der Abschluss von Warenkreditversicherungen enthebt nicht von der nötigen Marktbeobachtung. Vielmehr müsse man „täglich schauen, ob sich etwas geändert hat“.
Der große Vorteil der Warenkreditversicherung bestehe in der Flexibilität bei der Absicherung der Holzerlöse für die Forstwirtschaftlichen Vereinigungen. Im Schadensfall erstattet die Versicherung 90 % der versicherten Summe. Zudem übernimmt die Versicherung im Schadensfall für die FVen auch Inkasso-Aufgaben. Ziel ist es, auch die restlichen zehn Prozent wieder hereinzuholen, wie Ulrich und Ermert erklärten. Zu beachten sind in jedem Fall steuerliche Aspekte, wie in der Diskussion deutlich wurde. Zugleich zeigte sich beim Thementisch, dass viele FVen noch keine Erfahrungen mit Warenkreditversicherungen haben, das Interesse auch an den Feinheiten der Policen aber groß ist. Ein zusätzliches Plus der Warenkreditversicherung: „Neukunden können mit der Versicherung schnell eingeschätzt werden“, erklärte Ermert. Denn die Bewertung von Schuldnern (Debtor-Risk-Assessment – DRA) ermögliche, das Risiko von Zahlungsausfällen für jedes Unternehmen zu messen. Die DRA-Skala ist elfteilig, von 1 (sehr hoch) bis 10 (niedrig), während die 0 für Ausfall/inaktiv steht.
Perspektivisch sehen Ermert und Ulrich die Möglichkeit, die Versicherung mit anderen FVen zusammenzulegen. Die Kosten für die Versicherung könnten weiter verringert werden.
Thementisch 3: Möglichkeiten und Grenzen von Windenergieprojekten im Kleinprivatwald
Text: Alexander Knebel
Welche Möglichkeiten bieten sich für Waldeigentümer zur Teilhabe an Windenergieprojekten im Wald über die klassische Flächenverpachtung hinaus? Darum ging es beim von Dr. Markus Hecker geleiteten Thementisch. Der Geschäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Lüneburg GmbH (FVL) stellte dazu Optionen vor, auch anhand der Aktivitäten seines unter dem Markennamen „Waldmärker“ bekannten FWZ im Landkreis Lüneburg: Die Waldmärker engagieren sich für die Projektierung und den späteren Betrieb zweier Windparks selbst als Gesellschafter mit allen damit verbundenen Risiken. Damit ist der FWZ direkt am Betrieb der Windparks beteiligt, sobald sich dort die Rotoren in den kommenden Jahren drehen. Konkret geht es um zwei Projekte für Wind im Wald im Landkreis Lüneburg mit insgesamt gut 20 Windkraftanlagen. Der Wald an den beiden Standorten ist von Kiefer geprägt und steht im Eigentum der Mitglieder der örtlichen Forstbetriebsgemeinschaften. „Mit unserem Modell ermöglichen wir Teilhabe am Ertrag durch erneuerbare Energien für die Flächeneigentümer und auch für weitere Mitglieder unseres Forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses“, erläuterte Hecker. Ziel des Projektansatzes: die Windenergie als innovatives Geschäftsfeld der Waldmärker fest verankern und die Wertschöpfung erhöhen. Darüber hinaus versprechen sich die Waldmärker eine erhöhte Akzeptanz für die Windkraft vor Ort, wenn die Projekte als Bürgerwindpark oder als Energiegenossenschaft mit Partnern aus der Region umgesetzt werden. „Wenn neben Pacht und Gewerbesteuer auch die übrigen Erträge in der Region bleiben, sorgt das bei Kommunen und Bürgern für umfassende Einnahmen, sodass alle Betroffenen auch an Erträgen aus den Projekten partizipieren“, umriss Hecker die Vorzüge. Als weitere Option für starkes Engagement von FWZ in der Windkraft stellte Hecker die Schaffung einer Energiegenossenschaft vor, welche aus Mitgliedern der FWZ besteht und als Gesellschafterin in reinen Projektierer- windparks auftreten kann.
Die Thementisch-Teilnehmenden zeigten Respekt für die Option, in der die FWZ auch als Projektierer auftritt. Deutlich wurde im Austausch der FWZ aus verschiedenen Bundesländern aber auch, wie viel Aufwand im Vorlauf und Genehmigungsprozess stecken, von der Willensbildung vor Ort über die Erstellung von Gutachten bis hin zu weiteren administrativen Schritten. Ihre Kompetenzen können Waldeigentümer bei Windenergieprojekten übrigens auch bei der notwendigen Beschaffung von Ausgleichsflächen einbringen. So könnte der naturschutzrechtliche Ausgleich laut Hecker z. B. auch durch einzubringende Schutzprojekte zu bestimmten Arten oder Totholz erfolgen. Der ebenfalls notwendige waldrechtliche Ausgleich müsse durch Erstaufforstung erfolgen. „Mit ihrer Rolle als Selbsthilfe-Organisation des Waldbesitzers und mit ihren waldbaulichen Kompetenzen haben Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse große Möglichkeiten, sich bei Windkraftprojekten als innovativem Geschäftsfeld einzubringen, vorausgesetzt die regionalen Voraussetzungen stimmen“, erklärte Hecker. In Niedersachsen war Ende 2021 eine Öffnung für Windkraftprojekte im Wald erfolgt.
Waldmärker-Geschäftsführer Hecker gestand zu: Ein Windpark als „Millionenprojekt“ mag auf den ersten Blick abschreckend wirken. Doch gelte es, der Investitionssumme den über Jahre und Jahrzehnte hinaus zu erwartenden Stromertrag gegenüberzustellen.
Thementisch 4: Kennzahlenvergleich für Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse
Text: Leon Nau
Brauchen Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse Kennzahlensysteme, um durch das Lernen von den Besten ihre Organisation effektiver steuern zu können? Dieser Frage stellten sich die Teilnehmer 2024 beim entsprechenden BuKo-Thementisch. Gespeist wurde die Diskussion aus mehrjähriger Erfahrung. Denn bereits beim Bundeskongress Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse im Jahr 2017 stand die Frage nach betriebswirtschaftlichen Eckdaten auf dem Programm und wurde rege diskutiert. Damals wurde festgehalten, dass der Vergleich mit dem Besten einer Branche ein wichtiges Instrument im Werkzeugkoffer jeder Führungskraft eines Zusammenschlusses sein sollte. Aus den seinerzeit generierten Ergebnissen entstand die Idee für das bundesweite Benchmarking Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse, das mit einem erfolgreichen Projektantrag und anschließender Förderung über das Bundeslandwirtschaftsministerium realisiert werden konnte. Im Jahr 2020 startete das Projektteam, bestehend aus der AGDW – Die Waldeigentümer und unique land use GmbH, mit der Entwicklung des Kennzahlensystems für Zusammenschlüsse. Nach erfolgreicher Entwicklung und Pilotphase wurde 2024 das ausgereifte Kennzahlensystem in seiner Anwendung vorgestellt und die ersten Ergebnisse präsentiert (s. ausführlicher Bericht im Heft). Ein Fokus der Diskussion: die Nachwirkungen der Krisenjahre im Zuge anhaltender Kalamitäten. Mit Hilfe einer Profitcenter-Betrachtung der Geschäftsfelder und Leistungsbereiche der Zusammenschlüsse wurde ersichtlich, dass mit dem Rückgang der Einnahmen aus der Holzvermarktung auch die Gesamtergebnisse der Zusammenschlüsse gesunken sind. Hier wurde die Abhängigkeit vom Geschäftsfeld Holz deutlich. Die Teilnehmenden betonten dahingehend die Bedeutung effektiver Fördermaßnahmen, den Stellenwert langfristiger Planbarkeit für die Zusammenschlüsse wie auch eine Diversifikation der Geschäftsfelder und zeigten hohes Interesse und auch Bereitschaft an dem Benchmarking für FWZ teilzunehmen.
Thementisch 5: Carbon-Credits als Beitrag zum Klimaschutz – Partizipation kleiner Betriebe und Rolle der FWZ
Text: Alexander Knebel
Zu den Ökosystemleistungen des Waldes gehört der Klimaschutz – eine Leistung, die Waldbesitzer derzeit unentgeltlich erbringen. Welche Möglichkeiten zu ihrer Inwertsetzung bestehen, wurde beim Thementisch „Carbon-Credits als Beitrag zum Klimaschutz“ erörtert. Es geht um Kohlenstoff-Gutschriften für konkret erbrachte Klimaschutzleistungen im Wald. Wie Benjamin Munzel vom Unternehmen ClimatePal erklärte, äußern Firmen aus Deutschland explizit den Wunsch, Waldprojekte zu fördern. „Andererseits stagnierte der globale Markt für Klimaschutz-Zertifikate aus Waldprojekten zuletzt angesichts von Bedenken hinsichtlich seiner Umwelt- und sozialen Integrität“, konstatierte Munzel vor dem Hintergrund kritischer Berichterstattung zu Projekten in Übersee. Umso schwieriger scheint es da, kleine Betriebe und FWZ in Deutschland für „Carbon-Credits“ zu gewinnen.
Könnte sich das durch den neuen EU-Rechtsrahmen ändern, der den freiwilligen Kohlenstoffmarkt ab 2026 regulieren wird? Die entsprechende Regulierung ist vom Europaparlament verabschiedet und wird aktuell von der EU-Kommission konkreter ausgestaltet. „Die EU-Institutionen haben festgeschrieben, dass unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand zu vermeiden ist, insbesondere für Eigentümer kleiner Privatwälder. Die EU hat außerdem anerkannt, dass es gerade auch Eigentümern im Kleinprivatwald an Detailwissen fehlen kann, um ‚Carbon-Farming‘-Aktivitäten umzusetzen. Daher sollen Beratung, Wissenstransfer und Fortbildung finanziert und leicht zugänglich gemacht werden“, so Munzel.
Er stellte auch den aktuellen rechtlichen Rahmen jenseits der „Carbon-Credits“ vor, sofern er für den Kohlenstoffmarkt relevant ist. Die neuen Vorgaben, so auch zu umweltbezogenen Aussagen (Green Claims), sollen ab 2026 die Zertifizierung der Kohlenstoffentnahme aus der Atmosphäre („Carbon Removal Credits“) und entsprechende Marketingbotschaften der Käufer regeln.
Konkreten Zertifizierungsbedingungen bei Waldprojekten widmete sich beim Thementisch Co-Referent Hans Jacobs von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. „Internationale Carbon-Credit-Zertifizierungssysteme wie der Gold-Standard und Verra wenden etablierte Methoden an, welche die CO2-Minderungen durch verbesserte Waldbewirtschaftung und (Wieder-)Aufforstungsaktivitäten beziffern. Die Qualifikation für die Ausschüttung von Carbon-Credits hängt unter anderem von der Dauerhaftigkeit der CO2-Minderungen ab. Zudem muss die Minderung der CO2-Emissionen nachgewiesenermaßen zusätzlich erfolgen“, erläuterte Jacobs. Er ging auch auf das erste deutsche Waldprojekt ein, das seit März 2024 unter einem großen Zertifizierungssystem registriert ist. „In den vergangenen Jahren entstanden daneben nationale Zertifizierungssysteme, die auf deutsche Waldprojekte besser zugeschnitten sind“, konstatierten Munzel und Jacobs.
Unter den Diskierenden beim Thementisch wurden der CO2-Markt und dessen Möglichkeiten für Waldbesitzende als komplex wahrgenommen. Fragen warfen nicht zuletzt Kostenaspekte und Erträge sowie Überschneidungen mit anderen regulatorischen Rahmen und Förderungen auf.
Die Referenten stellten beim Thementisch fest, dass die Projektentwicklung hohen Aufwand mit sich bringe, der derzeit nur für größere Betriebe und Verbundprojekte abbildbar sei.
Hintergründe und Erläuterungen zum Thema bietet auch das im Frühjahr 2024 erschienene Gutachten „Möglichkeiten des Carbon Crediting für Waldbesitzende“, welches die AGDW und die Familienbetriebe Land und Forst beauftragt hatten.
Carbon Credits als Beitrag zum Klimaschutz
Der wachsende Markt der zertifizierten CO2-Gutschriften braucht eine transparente Aufstellung, praxisorientierte Regelungen auf europäischer Ebene und unbürokratische, leichtere Zugänge auch für kleinere Betriebe. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie der ClimatePal Services GmbH im Auftrag der AGDW – Die Waldeigentümer und Familienbetriebe Land & Forst. Die ClimatePal-Studie hat sich mit den aktuellen Modellen und Wirkungsweisen des Carbon-Creditings befasst. Die Untersuchung hat die unterschiedlichen Komplexe wie Zertifizierung, Validierung, Ausschüttung und Handel einbezogen, das Zusammenspiel und die Prozesse analysiert. Daneben wurden auch der rechtliche und der politische Kontext in die Betrachtung einbezogen.
Alexander Knebel
ist ist Pressesprecher der AGDW – Die Waldeigentümer e. V. Leon Nau, lnau@waldeigentuemer.de, ist Referent für Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und Benchmarking bei der AGDW - Die Waldeigentümer. Nina Meyer leitet das Unternehmen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nina Meyer, mail@pr-meyer.de.
✔ Immer und überall verfügbar – auf Ihrem Tablet, Smartphone oder Notebook
✔ Sogar im Offlinemodus und vor der gedruckten Ausgabe lesbar
✔ Such- und Archivfunktion, Merkliste und Nachtlesemodus